katechismus21

Reliquien
Für Quiz ist der Text so formuliert, dass beim Vorlesen (ohne die Klammern) zunehmend deutlich wird, um welchen Begriff es sich handelt.
Überbleibsel oder Zurückgelassenes, so könnte man dieses Wort (Reliquien) übersetzen. Damit man mit Heiligen auch über den Tod hinaus in Verbindung sein kann, sind in vielen katholischen Kirchen solche Überbleibsel in Altäre eingelassen.
Es (Reliquien) sind die irdischen, handfesten Überreste von Heiligen, wie Knochen. Es sind aber auch Gegenstände, die diese während ihres Lebens benutzten.
Ist die Antwort noch nicht gefunden, so stehen vier Begriffe zur Auswahl:
| Devotionalien | Amulette |
| Urnen | Reliquien |
Zusatzinformationen zu Reliquien:
↓Besondere Reliquien
↓ Reliquienverehrung & Anbetung
↓ Reliquienhandel
Besondere Reliquien
Eine Reliquie ist ein anerkanntes Stück vom Körper eines Heiligen bzw. einer Heiligen oder ein Gegenstand, mit dem ein Heiliger in Berührung gekommen ist (Berührungsreliquie). Man sprach und spricht solchen Gegenständen Heilkräfte und Wunderkräfte zu.
Die Taschentücher, die Paulus benutzt hatte, sollen laut Bibel Menschen geheilt haben. In der Bibel steht: So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken - und die Krankheiten wichen von ihnen, und die bösen Geister fuhren aus. (Apostelgeschichte 19,12).
Die bekannteste Reliquie ist das Leichentuch Jesu, das Turiner Grabtuch, in das Jesus Christus nach der Abnahme vom Kreuz gewickelt war. Es wird in der Grabtuchkapelle des Turiner Doms aufbewahrt.
Es gibt Splitter des Kreuzes, an dem Jesus Christus den Tod fand (aufbewahrt in der Kirche Sankt Magdalena in Fürstenfeldbruck), eine Windel, in die Jesus als Kind gewickelt war (aufbewahrt im Aachener Dom), die Krippe Jesu Christi, in die er nach der Geburt gelegt war (zu finden in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom).
Zu den besonderen Reliquien gehören auch die Gebeine der Heiligen Drei Könige - siehe ↓ weiter unten auf dieser Seite.
Reliquienverehrung
Im Mittelalter bis hinein in die Neuzeit hatte die Verehrung von Heiligen ihre Blütezeit. Verehrt wurden nicht nur die Heiligen selbst, sondern auch ihre Reliquien, also ihre Hinterlassenschaften. Es entstand ein regelrechter Handel mit Knochen, Kleidungsstücken und auch Gegenständen, denen man nachsagte, Heilige hätten sie besessen oder auch nur berührt. So gehörte und gehört zur Volksfrömmigkeit "das Küssen der Reliquien, der Schmuck mit Lichtern und Blumen, der mit ihnen erteilte Segen, das Mittragen bei Prozessionen, nicht ausgeschlossen die Gewohnheit, sie zu den Kranken zu bringen, um sie zu stärken und die Bitte um Heilung zu bekräftigen (...) Die Gläubigen beten vor Heiligenbildern in den Kirchen oder in den eigenen Wohnungen. Sie schmücken sie mit Blumen, Lichtern und Edelsteinen. Sie grüßen sie in verschiedenen Formen der religiösen Anhänglichkeit. Sie tragen sie in Prozessionen mit und versehen sie als Zeichen der Dankbarkeit mit Weihegaben. Sie stellen sie in Nischen, auf Feldern oder in Kapellen an Wegen auf." (Aus den "Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls", verschiedene Hefte)
Reliquienhandel
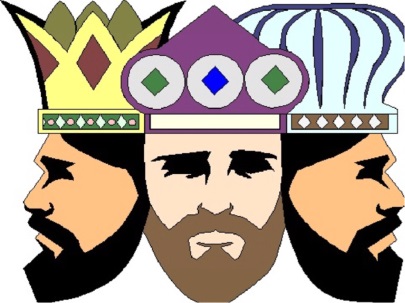
Die wertvollsten Reliquien sollen von Christus selbst stammen wie die Dornenkrone, das Grabtuch, ein Splitter vom Kreuz, an dem Jesus den Tod fand und der Heilige Rock. Mit Reliquien wurde reger Handel und auch reger Schindluder getrieben, denn sie brachten den Besitzern Ansehen und Reichtum.
Ein hervorragendes Beispiel für seltsamen Reliquienhandel sind die Gebeine der Heiligen drei Könige, die nach langen Wegen und Umwegen im Kölner Dom landeten und diesen insbesondere dadurch berühmt machten und zum Anziehungspunkt von Pilgern aus der ganzen Welt. Die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, hatte die Gebeine schon um das Jahr 300 aus Palästina nach Byzanz (dem heutigen Istanbul) gebracht; von dort gelangten sie nach Mailand, wurden von Kaiser Barbarossa gestohlen, der sie 1164 dem Kölner Erzbistum schenkte. Sehr hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei diesen Knochen nicht wirklich um die Gebeine der Heiligen Drei Könige handelt!